
Visuelle Wahrnehmungsstörungen bei Schülerinnen und Schülern erkennen
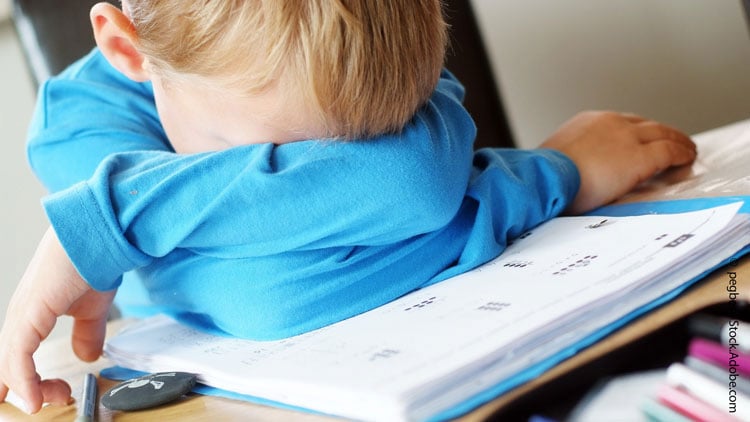
Lernschwächen und Lernstörungen wie Legasthenie oder Dyskalkulie sind inzwischen vielen Lehrkräften bekannt und glücklicherweise werden betroffene Schülerinnen und Schüler heute nicht mehr vorschnell als „weniger intelligent“ abgestempelt.
In den vergangenen Jahren wurde viel Aufklärungsarbeit geleistet. Es gibt inzwischen Anlaufstellen für Lehrkräfte und Eltern, die dabei helfen, festzustellen, ob eine Lernschwäche die Ursache für die Lernprobleme eines Kindes sein könnte. Frühzeitig erkannt, kann den Kindern meist gut geholfen werden.
Weniger bekannt, aber ebenfalls bedeutsam für den schulischen Lernerfolg, sind sogenannte Wahrnehmungsstörungen – insbesondere im taktilen, auditiven oder visuellen Bereich. Sie können sich auf das Lesen, Schreiben, Rechnen oder auch das Verhalten im Unterricht auswirken, werden aber häufig übersehen. Ich selbst bin durch einen Fall im Familienkreis auf visuelle Wahrnehmungsstörungen aufmerksam geworden, was mich zu diesem Beitrag veranlasst hat.
Denn die Grundvoraussetzung für Lehrerinnen und Lehrer, um überhaupt vermuten zu können, dass sich eine Lernschwäche oder eine Wahrnehmungsstörung hinter den Problemen von Schülerinnen und Schülern verbergen könnte, ist das Wissen um sie.
Aber woran lassen sich visuelle Wahrnehmungsstörungen erkennen? Und wie können Sie betroffene Kinder gezielt unterstützen?
Was sind visuelle Wahrnehmungsstörungen?
Bei Kindern mit visuellen Wahrnehmungsstörungen ist das Sehen an sich meist nicht beeinträchtigt: Die Augen funktionieren in der Regel ganz normal. Die Schwierigkeit liegt vielmehr in der Verarbeitung der visuellen Reize im Gehirn.
Die betroffenen Kinder sehen zwar, was auf der Tafel oder im Buch steht, doch das Gehirn hat Mühe, die Informationen richtig aufzunehmen, zu unterscheiden, einzuordnen oder zu interpretieren. Man spricht daher auch von einer visuellen Wahrnehmungs- oder Verarbeitungsstörung.
Solche Verarbeitungsprobleme können sich ganz unterschiedlich äußern und hängen nicht mit der Intelligenz oder Motivation der Kinder zusammen. Abhängig von Art und Ausmaß kann das zu unterschiedlichen Beeinträchtigungen und Lernproblemen führen. Infolgedessen können auch Verhaltensauffälligkeiten auftreten.
Oft werden die schulische Probleme, die daraus entstehen können, fälschlicherweise als „Unkonzentriertheit“, „Schlampigkeit“ oder „Faulheit“ wahrgenommen. Umso wichtiger ist es, die Hintergründe zu kennen und genauer hinzuschauen.
Symptome erkennen: So äußern sich visuelle Wahrnehmungsstörungen
Visuelle Wahrnehmungsstörungen können sich bei jedem Kind unterschiedlich zeigen, oft subtil und nicht auf den ersten Blick erkennbar. Die folgenden Punkte sind Beispiele für mögliche Beeinträchtigungen, die allerdings nicht gebündelt auftreten müssen und neben denen es noch weitere gibt.
Beim Lesen:
- Häufiges Überspringen von Zeilen oder einzelnen Wörtern
- Weglassen von Endungen oder Silben
- Buchstabendreher oder -verwechslungen (z. B. b/d, p/q)
- Schwierigkeiten, den Sinn des Gelesenen zu erfassen
Beim Schreiben:
- Buchstabendreher oder -verwechslungen (z. B. M statt W)
- Schwierigkeiten, in Linien zu schreiben
- Unleserliche Handschrift
- Probleme beim Nachspuren von Linien oder Buchstaben
In Mathematik:
- Zahlendreher (z. B. 84 statt 48)
- Verwechslung ähnlicher Zahlen (z. B. 6 und 9)
- Probleme bei der Unterscheidung des Größer-/Kleinerzeichens
- Probleme beim Lernen der Uhrzeit mit analogen Uhren
Im Raum:
- Probleme mit der räumlichen Wahrnehmung (oben/unten, links/rechts, vorne/hinten)
- Orientierungsschwierigkeiten
- Probleme, Entfernungen und die Geschwindigkeit bewegter Objekte einzuschätzen
Mögliche Folgen
Die Beeinträchtigungen können zu Konzentrationsproblemen oder schnellem Ermüden bei visuellen Aufgaben führen.Das Kind kann dadurch dem Unterricht nicht so gut und schnell folgen kann, wie seine Mitschülerinnen und Mitschüler. Auch Hänseleien oder einer Ausgrenzung des betroffenen Kindes ist möglich.
Mögliche Folgen:
- Schulangst und Vermeidung bestimmter Fächer
- schwindende Motivation
- keine Lust mehr Lesen, Schreiben oder Rechnen zu üben
Manche Kinder reagieren aufgrund der häufigen Misserfolge mit Verhaltensauffälligkeiten, die zu weiteren Schwierigkeiten in der Klasse führen können.
Die Beeinträchtigungen führen zu schlechteren schulischen Leistungen. Ohne Hilfe durch geeignete Maßnahmen führt dies zu schlechteren oder fehlenden Schulabschlüssen.
Was tun, wenn Sie eine visuelle Wahrnehmungsstörung vermuten?
Um festzustellen, ob tatsächlich eine visuelle Wahrnehmungsstörung vorliegt, muss untersucht werden, ob sie als Ursache für die Probleme in Frage kommt. Durch teilweise ähnliche Anzeichen ist sonst eine Verwechslung beispielsweise mit LRS, Rechenschwäche oder AD(H)S möglich.
Wenn die Ursache der Lernprobleme geklärt ist, können eine passende Therapie und weitere unterstützende Maßnahmen helfen, diese zu überwinden. Zwar können sich die Schwierigkeiten mit der visuellen Wahrnehmung im Laufe der kindlichen Entwicklung von selbst verbessern, wenn es sich um eine vorübergehende Wahrnehmungsschwäche handelt, doch dann könnte bereits ein schulisches Lerndefizit entstanden sein, das schwer wieder aufgeholt werden kann.
1. Gespräch mit den Eltern
Als Lehrkraft sollten Sie bei einem Verdacht auf eine Wahrnehmungsstörung zunächst das Gespräch mit den Eltern suchen:
- Schildern Sie Ihre Beobachtungen sachlich und wertfrei.
- Fragen Sie nach Auffälligkeiten im Alltag oder in der Freizeit.
- Ermutigen Sie die Eltern, eine fachliche Abklärung einzuleiten.
So entsteht ein gemeinsames Verständnis und ein erster Schritt zu möglicher Unterstützung wird gemacht.
2. Diagnose stellen lassen
Um sicherzugehen, ob eine visuelle Wahrnehmungsstörung wirklich die Ursache für die schulischen Probleme ist, sollte ein Experte/eine Expertin aufgesucht werden. Die Diagnose erfolgt oft in Zusammenarbeit mehrerer Fachpersonen. Kinderärztinnen und -ärzte sind meist die erste Anlaufstelle.
Dort können Fachleute (z. B. Augenärztinnen/Augenärzte oder Orthopistinnen/Orthoptisten) für eine weitergehende Diagnose empfohlen werden. Auch Psychologinnen und Psychologen, Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten sowie Hailpädagoginnen und Heilpädagogen können bei einer Diagnosestellung einbezogen werden.
Bei der Diagnostik werden in der Regel überprüft:
- Sehschärfe, Augenbewegungen und beidäugiges Sehen
- Lernverhalten und individuelle Stärken
- Wahrnehmungsverarbeitung durch standardisierte Tests
So kann überprüft werden, ob eine behandlungsbedürftige visuelle Wahrnehmungsstörung vorliegt und wie geeignete Maßnahmen aussehen können.
Aber auch wenn es sich „nur“ um eine vorübergehende Wahrnehmungsschwäche handelt, können die unten aufgeführten Punkte den betroffenen Kindern das Lernen erleichtern.
3. Therapie und unterstützende Maßnahmen
Wenn körperliche Ursachen vorliegen, die behandelt werden können, wird dies der erste Schritt sein. Oft können aber keine körperlichen Gründe ausgemacht werden. Spezielle Übungen sollen helfen, die Fähigkeiten zu trainieren, bei denen Defizite bestehen. Helfen kann beispielsweise eine Ergotherapie oder eine heilpädagogische Begleitung. Was genau sinnvoll ist, hängt von den individuellen Ursachen und Beeinträchtigungen ab.
Wichtig ist, dass Eltern, Therapeutinnen und Therapeuten und Lehrkräfte sich regelmäßig austauschen, um das Kind bestmöglich zu fördern.
Wie Sie als Lehrerinnen und Lehrer Kindern mit visuellen Wahrnehmungsstörungen helfen können
Je nachdem, wo die Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler liegen, gibt es unterschiedliche Ansätze, ihnen das Lernen in der Schule zu erleichtern. Wichtig ist: Machen Sie sich bewusst, dass diese Kinder nicht „unaufmerksam“ oder „nachlässig“ sind, sondern mit einer zusätzlichen Herausforderung kämpfen.
Hier sind einige Punkte, die betroffene Kinder neben einer therapeutischen Begleitung unterstützen können:
Arbeitsplatz und Materialien:
- Geeigneten Sitzplatz bereitstellen (Licht, Nähe zu Tafel und Projektionsflächen).
- Klare, kontrastreiche Arbeitsblätter mit großer, gut lesbarer Schrift
- Wenig überladene/verspielte Materialien – einfache, strukturierte Layouts erleichtern die Orientierung
- Hilfsmittel wie Lesefenster, Lineale oder Fingerführung erlauben
- Weitere Hilfsmittel wie Lupen, Lesegeräte, Tablets oder Computer (Vergrößerungsfunktion, Vorlese-Apps oder Texterkennungs-Software) erlauben
- Markierungshilfen (z. B. Textmarkerband, Farbmarkierungen) zur besseren Orientierung
- Alternative Lineaturen bei Schreibheften anbieten (zu viele Linien können Kinder mit visuellen Wahrnehmungsstörungen eher durcheinanderbringen als helfen)
Zeit und Tempo:
- Mehr Zeit zum Abschreiben von Texten und Tafelbildern, Hausaufgaben oder Tests gewähren
- Aufgabenumfang reduzieren, ohne Lernziele zu verändern
- Korrekturfreundlich bleiben – nicht jedes formale „Fehlermuster“ bewerten, wenn es auf die Wahrnehmung zurückzuführen ist
Vermittlung und Kommunikation
- Aufgabenstellungen vorlesen oder erklären, auch bei schriftlichen Arbeiten
- Regelmäßige kurze Wiederholungen oder Visualisierungen zur Festigung von Inhalten
- Rückmeldung einfühlsam und ermutigend formulieren – positive Verstärkung stärkt das Selbstvertrauen
Ferdinand-Porsche-Str. 6
73479 Ellwangen
E-Mail: [email protected]
Datenschutz
Impressum
Cookies
Ferdinand-Porsche-Str. 6
73479 Ellwangen
E-Mail: [email protected]
Impressum
Datenschutz
Cookies



