
Das Lesetheater: Eine kreative Methode zur Leseförderung
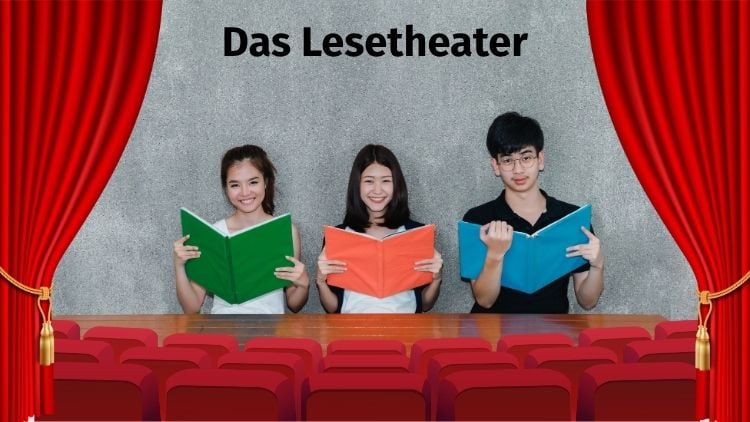
Lesen ist eine Schlüsselkompetenz, doch viele Kinder verlieren schnell die Lust daran, wenn das Lesen nur als Pflicht empfunden wird. Das Lesetheater schafft hier Abhilfe: Das Lesetheater verbindet das Vorlesen von Texten (deshalb wird es oft auch als „Vorlesetheater“ bezeichnet) mit einer szenischen Darstellung ähnlich einer Theateraufführung. Es fördert so nicht nur die Leseflüssigkeit, sondern auch die Freude am Umgang mit Texten.
In diesem Beitrag erhalten Sie Infos zum Einsatz des Lestheaters im Unterricht sowie zur Vorbereitung und Durchführung.
Geeignet für: ab Klasse 2 (Basislesefertigkeiten nötig), in höheren Klassen können weitere kreative Aufgaben dafür sorgen, dass das Lesetheater spannend und herausfordernd bleibt
Förderschwerpunkte: Leseflüssigkeit, Textverständnis, Ausdrucksfähigkeit, soziale Kompetenzen
Das Lesetheater im Unterricht
Die Methode „Lesetheater“ wird überwiegend im DaZ- oder Deutschunterricht eingesetzt. Sie kann beispielsweise als kreative Ergänzung zu einer Lektüre, zur Festigung von Dialogstrukturen oder zur Differenzierung im Lesetraining dienen.
Je nach Lesefähigkeit können kürzere oder einfachere Rollen vergeben oder der Text farblich markiert und in kleinere Abschnitte unterteilt werden.
Ziel ist es, die Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler durch wiederholtes lautes Vorlesen zu verbessern. Damit die Kinder dabei auch mit Spaß und Motivation bei der Sache sind, kommen beim Lesetheater auch kreative und gestalterische Elemente zum Einsatz.
Die Schülerinnen und Schüler haben die Aufgabe, Texte nicht nur laut vorzulesen, sondern ihre Rolle durch
- Intonation,
- Stimmlage,
- Sprechweise,
- Mimik und
- Gestik mit Leben zu füllen und
- mit den anderen beteiligten Schülerinnen und Schülern zu interagieren.
So bereiten Sie das Lesetheater vor
- Kopieren Sie den Text, damit jeder Schüler und jede Schülerin ein eigenes Exemplar hat, in dem er seine Vorleseanteile markieren kann.
- Bevor es losgeht, sollten die Schülerinnen und Schüler den Text einmal komplett für sich durchlesen.
- Danach können sie die auftretenden Rollen untereinander verteilen.
- Wichtig ist dabei auch, dass sich die Kinder überlegen, wie sie die eigene Rolle interpretieren möchten, wie der Text zu deuten ist und wie sie die Lesung dahingehend anpassen können.
Als Einstimmung können Sie die Schülerinnen und Schüler Sätze in verschiedenen Stimmungslagen vorlesen lassen. Mal wütend, mal ängstlich oder fröhlich. - Die spielerischen Elemente sollten nicht zu viel Raum einnehmen. Der Fokus liegt eher auf dem Vorlesen und dem Arbeiten mit dem Text.
- Bevor die Aufführung beginnt, muss der Text durch wiederholtes szenisches Vorlesen so gut eingeübt werden, dass alle ihre Rolle sicher beherrschen.
Im Unterschied zu einer Theateraufführung müssen die Texte nicht auswendig gelernt, sondern dürfen (und sollen) vorgelesen werden. Requisiten sind beim Lesetheater nicht zwingend erforderlich.
Daraus entsteht der Vorteil, dass die Methode ohne große Vorbereitung im Unterricht umgesetzt werden kann.
Durchführung
Das Lesetheater eignet sich gut als Gruppenarbeit. So kann jede Gruppe einen anderen Text aufführen oder bei längeren Werken auch einen anderen Teil desselben Stücks. Möglich ist auch die Vergabe von nur einem Text an mehrere Gruppen, um verschiedene Interpretationen zu sehen.
Der Höhepunkt ist natürlich die Aufführung vor der Klasse. Dafür braucht es ein wenig Platz im Raum, damit sich die Spielenden frei bewegen können. Auch die Sitzordnung sollte so gestaltet werden, dass alle gut sehen und zuhören können. Und wie bei einer echten Theaterpremiere gilt: Applaus ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht!
Je nach Ausstattung kann die Aufführung auch aufgenommen werden – das motiviert zusätzlich und erlaubt eine spätere Selbstreflexion.
Feedbackrunde
Eine kurze Feedbackrunde nach der Aufführung hilft den Schülerinnen und Schülern, ihre Lesung zu reflektieren und voneinander zu lernen. Dabei steht nicht die Bewertung im Vordergrund, sondern eine wertschätzende Rückmeldung: Was ist gut gelungen und was kann beim nächsten Mal noch verbessert werden?
Ein einfacher Bewertungsbogen mit Leitfragen kann dabei helfen, die Rückmeldung zu strukturieren. Hier haben wir einen entsprechenden Bogen für Ihren Unterricht zum Download vorbereitet:
Welche Texte eignen sich für das Lesetheater?
Für jüngere Kinder oder Lernende, die das Lesetheater noch nicht kennen, eignen sich kurze, dialogreiche Texte mit klar verteilten Rollen – zum Beispiel aus Bilderbüchern, Märchen oder einfachen Theaterstücken. Wichtig ist, dass die Texte gut verständlich und altersgerecht formuliert sind.
Erfahrenere Schülerinnen und Schüler können einen erzählenden Text eigenständig in ein Vorlese-Skript umarbeiten. Dabei wird der Text in Sprechrollen aufgeteilt und überwiegend in wörtlicher Rede umgeschrieben, evtl. inklusive einer möglichen Erzählerrolle. Das fördert das Textverständnis und die kreative Auseinandersetzung mit Sprache. Geeignet sind besipielsweise Sagen, Fabeln, literarische Texte, Ausschnitte aus Jugendbüchern oder Theaterstücken.
Auch selbst geschriebene kleine Texte können beim Lesetheater vorgetragen werden.
Welche Ziele können mit der Methode „Lesetheater“ erreicht werden?
Die Schülerinnen und Schüler …
- … lesen durch wiederholtes, lautes Vorlesen flüssiger und sicherer.
- … haben mehr Freude am Lesen durch spielerische und kreative Elemente.
- … setzen sich intensiv mit dem Textinhalt auseinander und verbessern ihr Textverständnis.
- ... stärken ihre Ausdrucksfähigkeit durch bewusste Modulation von Stimme, Mimik und Gestik.
- ... lernen, wie sprachliche Mittel Stimmungen erzeugen und wirken können.
- … erfahren positive Verstärkung durch Applaus und Feedback, was das Selbstbewusstsein stärkt.
- … lernen, Texte kreativ umzuwandeln und eigenständig vorzubereiten – besonders in höheren Klassen.
- … trainieren soziale Kompetenzen wie Teamarbeit, Absprachen und konstruktives Feedbackgeben.
- ... erweitern ihren Wortschatz und ihre Sprachkompetenz – besonders förderlich für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ).
Ferdinand-Porsche-Str. 6
73479 Ellwangen
E-Mail: [email protected]
Datenschutz
Impressum
Cookies
Ferdinand-Porsche-Str. 6
73479 Ellwangen
E-Mail: [email protected]
Impressum
Datenschutz
Cookies



